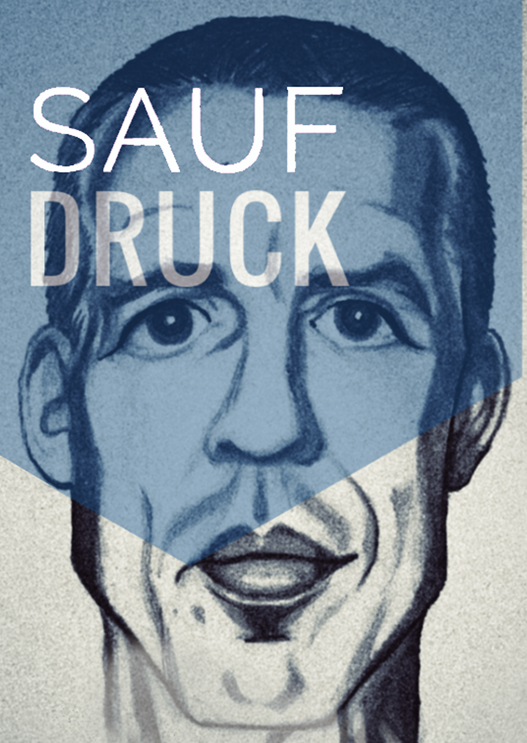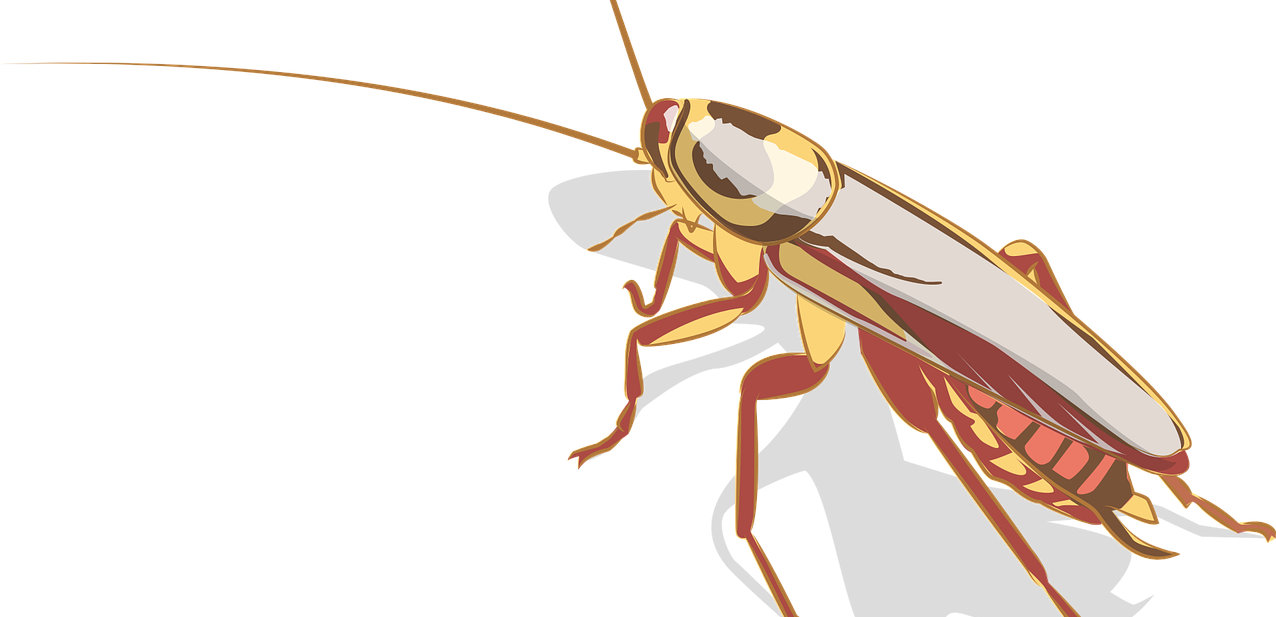Ich stehe vor dem Badezimmerspiegel, binde mir die Krawatte und stelle fest, dass ich heute mehr einer Schabe denn einem Menschen ähnele … oder: Kafka lässt herzlich grüßen.
Als ich an einem Donnerstagmorgen das Frühstücksei aufklopfen wollte, bemerkte ich verwundert, dass ich den silbernen Löffel in zwei Teile zerbrochen hatte. Ich schaute auf meine rechte Hand und dort, wo ansonsten blaue Adern die braune Haut durchfurchten und sich fünf Finger geschmeidig bewegten, erblickte ich zwei schwarze Scheren.
Nanu, dachte ich und rieb mir mehrmals über die Augen, weil ich glaubte, noch nicht richtig wach zu sein. Probehalber bohrte ich die Gabel, die links neben dem Marmeladenbrötchen lag, in den Oberschenkel hinein und stellte fest, dass ich keinen Schmerz spürte. Allerdings besaß ich erstaunlicherweise sechs Beine, von denen vier nackt waren, da meine Hose, die ich vorhin angezogen hatte, nur zwei bedeckte. Wann mag diese Verwandlung stattgefunden haben? überlegte ich.
Vorhin im Badezimmer beim Rasieren hatte ich auf jeden Fall noch nichts Außergewöhnliches an mir entdeckt.
Nach dem Aufstehen: 6 Beine und die Schuhe passen nicht mehr
Ich beschloss, mich erneut im Spiegel zu betrachten. Anstatt wie gewöhnlich mühelos auf die Füße zu gelangen, fiel ich beim Versuch aufzustehen jäh auf den Teppichboden und zappelte dort wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken, derweil meine sechs behaarten Fühler wild hin und her ruderten und die schwülwarme Sommerluft in meinem Esszimmer von links nach rechts schaufelten. Für diesen Unsinn habe ich jetzt keine Zeit, denn ich werde in einer dreiviertel Stunde im Büro erwartet, ging es mir durch den Kopf. Ich gab mir einen Ruck, drehte mich mit Schwung hundertachtzig Grad um meine Achse und stemmte mich mühsam in die Höhe.
Die pinke Krawatte schnürte mir ein wenig den Hals zu, das dunkelblaue Hemd knöpfte ich auf, da ich mich darin heute sehr beengt fühlte, Hose und Schuhe zog ich hingegen aus, weil sie mir keinen Nutzen mehr stifteten, Der Zeiger der Wanduhr rückte unerbittlich auf halb acht vor. Höchste Zeit, dass ich das Haus verließ. Auf allen sechsen eilte ich durch die Tür und hastete über den langen Flur. Ich nahm zehn Stufen auf einmal und erreichte innerhalb weniger Sekunden die Lobby unseres Appartementbaus. Die Aktentasche in meiner rechten Schere festgeklemmt sprang ich am Portier vorbei, der gerade Anweisungen an die Damen des Reinigungstrupps erteilte: »Bitte achten Sie heute penibel auf sämtliche Öffnungen in Spülbecken, Badewannen und Duschkabinen. Hier ist nachts eine Armada von Insekten gelandet. Muss an der Julihitze liegen, die seit Tagen in unserer Stadt brütet. Setzen Sie notfalls harte Chemikalien ein, um die Invasion zu bekämpfen.«
»Das ist interessant«, murmelte ich, während sich hinter mir eine giftgelbe Wolke ausbreitete und eine der Frauen keifte: »Da läuft gerade eine gigantische Schabe über die Marmorfliesen.« Sie fuchtelte mit einer Spraydose hinter mir her, von der mich drei Totenköpfe angrinsten. Als mich das Gas erreichte, begann ich zu husten und würgte zähen Schleim nach oben. »Sind denn heute alle verrückt geworden?«, schimpfte ich und quetschte mich durch die Drehtür, um draußen tief ein- und auszuatmen.
Neue Vorliebe für Schweiß und Achselhaare
Ich schnupperte neugierig am Auspuffrohr eines orangefarbenen Omnibusses und verspürte große Lust, dort hinein zu krabbeln, um die Wärme des Kohlenmonoxids zu genießen. Denn trotz der dreißig Grad, die das Thermometer bereits anzeigte, empfand ich die heutige Temperatur als kalt und mich fröstelte auf dem Weg zum Bahnhof. Auf den letzten Drücker erreichte ich die unterirdische Station. Die Türen der Linie 6 würden sich in wenigen Sekunden schließen. Ich stürmte in den mittleren Waggon und zwängte mich in die linke, hintere Ecke, wo ich mich an einer Stange festhalten konnte. Hier herrschten heilloses Gedränge nörgelnder Reisender und Gewühle transpirierender Leiber. Der Zug setzte sich langsam in Bewegung, verließ die hellerleuchtete Station, nahm Fahrt auf und wurde vom Dunkel des Tunnels verschluckt. Der korpulente Mann neben mir trug eine blassgrüne Synthetikweste direkt auf der bloßen Haut. Unter seinem in Richtung Haltegriff ausgestreckten Arm erspähte ich ein Büschel gekräuselter Achselhaare, die feucht im schummrigen Licht der Kabine glänzten. Geruch alter Ausdünstung stieg mir in die Nase. Mmh, dachte ich, ob ich mal daran lecken darf? Am nächsten Stopp stiegen mehr Personen ein als aus. Das ohnehin prall besetzte Abteil füllte sich immer mehr.
»Bitte bleiben sie weg von den Türen. Ansonsten können wir nicht weiterfahren«, dröhnte die verärgerte Stimme des Zugführers aus den Lautsprechern. Eine türkische Mutter mit Buggy blockierte den Eingangsbereich. Zwei in Schwarz gekleidete Hünen von der Security flitzten herbei und forderten die junge Frau auf, die elektronische Sperre freizugeben. Diese zuckte nur mit den Schultern, schien die Hinweise nicht zu verstehen. Die Sheriffs zerrten sie daraufhin aus dem Waggon heraus und gaben dem Schaffner das Signal zur Weiterfahrt.
»Unverschämtes Ausländerpack«, lispelte der schwitzende Dicke neben mir, während mir das Wasser im Munde zusammenlief, wenn ich auf die salzigen Schweißperlen gaffte. »Das würden die sich in Anatolien nicht trauen«, zischte er und glotzte Beifall heischend in die Runde. Die Menschen um ihn herum stierten gelangweilt auf den Boden. Niemand verspürte Lust, sich mit ihm auf ein Gespräch einzulassen. Die 6 rauschte nun aus dem unterirdischen Bahnsystem heraus in das gleißende Licht eines strahlenden Hochsommertags.
Die Sekretärin wird misstrauisch
An der Station Holland in Not krabbelte ich aus dem Wagen und lief so schnell ich konnte auf den gläsernen Wolkenkratzer Nr. 23 zu, der im Volksmund scherzhaft Nackte Gurke genannt wurde. Mit dem Expressaufzug gelangte ich innerhalb weniger Sekunden auf Stockwerk 50, raste durchs Treppenhaus drei Etagen nach unten und erreichte atemlos mein Zimmer 4711, von wo aus ich in ruhigen Stunden einen atemberaubenden Blick auf die Skyline unserer schönen Stadt genießen konnte. Allerdings stand mir der Sinn an diesem Morgen nicht nach gotischen Kathedralen und grünen Hügeln in der Ferne.
Die Sekretärin im Vorraum schien bereits darauf gewartet zu haben, dass ich den Schlüssel in der Tür drehte und die Aktentasche auf die Mahagoni- Tischplatte warf.
»Guten Morgen, Herr Vize-Abteilungsleiter«, empfing sie mich und strich sich mit der linken Hand eine blonde Strähne aus der Stirn, indessen sie mit der rechten die Geschäftspost vor mir ausbreitete. »Sie sehen heute schauderhaft aus«, sagte sie. »Als ob sie die ganze Nacht Party gefeiert haben. Beinahe hätte ich sie für eine riesige Madagaskarschabe gehalten. Gut, dass ich nicht schreckhaft bin. Ansonsten würde ich hysterisch auf den Flur laufen und dort laut um Hilfe rufen.«
»Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie Ihre Nerven im Griff haben«, antwortete ich. Sie starrte mich verwundert an und erwiderte: »Ich kann kein Wort von dem verstehen, was sie brummen. Wahrscheinlich haben Sie sich erkältet. Ich werde Ihnen Halspastillen besorgen, damit Sie Ihre Stimme wiederfinden.« Sie drehte sich abrupt um, balancierte auf weißen High Heels zurück an ihren Schreibtisch und wippte dazu im Takt mit ihren prallen Pobacken.
Da sie die Tür einen Spalt weit geöffnet ließ, konnte ich hören, wie sie das Telefon in die Hand nahm, eine kurze, hausinterne Nummer wählte und flüsterte: »Ihr müsst schnell machen!«
Hier geht es zu Teil 2.
Bild von Giampiero Ruggieri auf Pixabay