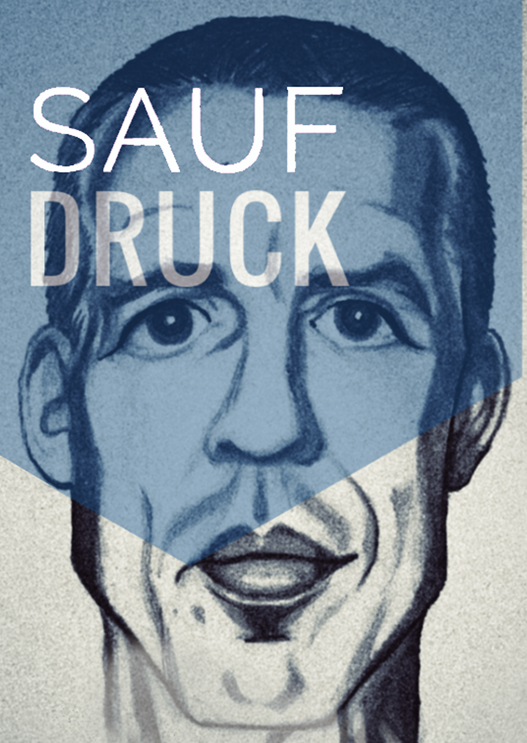Geschichte von der Mitpatientin, die alles Essen immer wieder auskotzte, bis sie eines Tages nicht mehr zum Frühstück erschien.
»Ich darf nicht mehr raus.«
»Weshalb? Du gehst doch jeden Tag für uns einkaufen, Miriam.«
»Sie lassen mich nicht mehr vor die Tür, Henning.«
»Das ist ärgerlich. Du warst die Einzige, der sie den Spaziergang erlaubt haben. Wer soll nun Zigaretten und Schokolade besorgen? Die Pfleger werden das nicht für uns tun. Da haben die bestimmt keinen Bock drauf.«
Miriam begann zu weinen.
»Was hast du denn ausgefressen?«
»Nichts!«
»Für ‚Nichts’ bekommst du keine Ausgangssperre. Du hast dich ja immer korrekt verhalten. Warst pünktlich zurück. Hast nicht versucht, Alkohol rein zu schmuggeln. Irgendwas muss vorgefallen sein, dass sie jetzt so streng mit dir sind.«
»Ich bin beim Wiegen unter vierzig Kilo gefallen.«
»Scheiße. Wusste ich nicht. Sorry.«
»Die Ärzte haben gesagt, dass ich dieses Mal nur ins Freie darf, wenn ich mich bemühe, zuzunehmen. Das klappt aber einfach nicht.« Miriam sah verzweifelt aus.
»Und das, obwohl du doppelt so viel isst wie ich.«
»Henning, du weißt, warum das so ist!«
»Ja ja, ich hör’s ja oft genug aus dem Nachbarzimmer.«
Trotz Astronautennahrung unter 40 Kilo
Miriam war eine superdünne Mitdreißigerin mit leicht schwäbischem Akzent, die es vor einiger Zeit berufsbedingt in unsere Gegend verschlagen hatte. Hübsches Gesicht, dunkle Haare. Sie musste früher gut ausgesehen haben. Rolf erzählte, dass sich die Typen bis vor ein paar Jahren nach ihr umgedreht und hinterher gepfiffen hatten. Von ihrem einstigen Glanz war heute nur noch wenig zu sehen. Die Krankheit forderte ihren Tribut; ließ sie ausgemergelt – mitunter sogar knochig – erscheinen. An guten Tagen war sie fröhlich, um dann über Nacht in Depressionen zu verfallen, die sie zwangen, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen. Dort saß sie dann stundenlang und starrte an die Wand. Es war in solchen Momenten schwer, ihr zu helfen, weil sie sich komplett einkapselte und niemanden an sich heranließ. Hin und wieder spielten wir abends zusammen Mühle oder Dame. Gar nicht meins. Ich tat es, weil es sie ablenkte. Der Spaß dauerte ohnehin nur eine Stunde, weil Miriam dann ermüdete. Jetzt hatte sie also – trotz hoch kalorienreicher Astronautennahrung und doppelter Portionen – die Grenze von vierzig Kilo unterschritten. Dem medizinischen Personal war das Risiko, dass Miriam mit einem Kreislaufkollaps draußen auf der Straße zusammenklappte, nun zu groß geworden. Aus Sicht der Ärzte war dieses Verbot vernünftig; für sie hingegen bedeutete es eine mittlere Katastrophe. Sie kam nun nicht mehr an die frische Luft. Miriam war seit sechs Wochen in der geschlossenen Abteilung. Die ersten Tage dienten der körperlichen Entgiftung. Danach war vorgesehen, sie langsam aufzupäppeln und in die Nähe der Fünfzigkilomarke heranzuführen. Anstatt zu- nahm sie jedoch immer mehr ab. Es war ein Trauerspiel.
Abendessen. 18.15.
»Ich habe noch drei Scheiben Wurst übrig. Möchte die jemand haben?«
»Ja ich, Henning.«
»Nimm dir ruhig auch noch das restliche Brot, Miriam.«
»Hat sonst noch jemand was übriggelassen?« Miriam blickte forschend durch den Speisesaal.
»Du kannst aber essen. Sieht man dir gar nicht an, Mädel. Wo lässt du das bloß alles?« Ein Neuer, den ich heute Morgen zum ersten Mal gesehen hatte, wollte seinen Senf dazugeben.
»Ist schon alles okay. Kümmere dich um deinen eigenen Teller«, sagte ich zu ihm.
Miriam verschwand mit einem vollgepackten Tablett in ihrem Raum. Sie schlief als einzige alleine. Wir anderen waren entweder in Doppel- oder in Dreierzimmern untergebracht. Ich legte mich kurz aufs Bett, um in Ruhe den Sportteil der Zeitung zu studieren. Von nebenan hörte ich es wieder: ein Würgen, Schluchzen, das Klatschen von Nahrung in die Kloschüssel. Miriam kotzte sich die Seele aus dem Leib. Diese grauenhafte Prozedur fand dreimal täglich statt. Immer zwanzig Minuten nach den Mahlzeiten. Miriam jagte sich zwei Flaschen Mineralwasser als Gleitmittel hinein, steckte zwei Finger in den Hals und los ging es. Anfangs dachte ich noch: Schade um das gute Essen. Bis ich die Tragweite ihres Krankheitsbildes begriff: Alkohol gepaart mit Bulimie. Rolf bezeichnete das als Komorbidität. Er war ein kluger Kopf. Würde schon stimmen, wenn er das sagte. Ich nannte es einfach: Doppeldiagnose.
Miriam flog öfter als Rolf, René oder ich hier ein. Und das wollte schon was heißen. Zumeist knapp unter vier Promille. Wenn’s mehr war, musste sie vorher eine Runde in der Intensivstation drehen. So lauteten die Regeln der Klinik. Galten für uns alle. Wenngleich bei ihr eine Flasche Wein dieselbe Wirkung hervorrief wie bei uns anderen eine Pulle Wodka. Mit vierzig Kilo verträgst du ja so gut wie nichts, ging es mir durch den Kopf. Kein Wunder, dass Miriam alle zweiundsiebzig Stunde hier aufkreuzte. Um diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, hatten die Ärzte dieses Mal auf einen mehrwöchigen Einweisungsbeschluss gedrungen. So blieb sie zwar trocken, verlor aber trotzdem weiterhin an Gewicht.
Verlegung in eine andere Klinik
Am nächsten Morgen. 10.25.
»Ich muss fort, Henning.«
»Wohin?«
»In eine andere Klinik.«
»Können sie hier nichts mehr für dich tun?«
»Ich wog vorhin nur noch neununddreißig. Da hat der Oberarzt gesagt, dass sich nun Spezialisten um mich kümmern werden.«
»Ist wahrscheinlich vernünftig.«
»Ich habe Angst.« Miriams Mundwinkel zuckten.
»Musst du doch nicht haben.« Ich berührte sachte ihr rechtes Handgelenk.
»Ich will nicht sterben.«
»Warum solltest du das tun? Du bist noch jung.«
»Es ist das erste Mal, dass sie mich woandershin überweisen. Sonst durfte ich immer nach Hause. «
»Und warst nach spätestens vier Tagen wieder hier. Kann verstehen, dass die Ärzte nun einen neuen Weg einschlagen wollen. Du musst echt zunehmen.
Wenn’s in dieser Station nicht funktioniert, dann eben in einer Spezialklinik.«
»Bringst du mich noch bis zur Tür, Henning?«
»Klar.«
Wir umarmten uns kurz, dann begleiteten zwei Pfleger Miriam auf den Parkplatz zum dort bereits wartenden Krankentaxi.
»Dann bleibt für uns ja ab sofort genug zu essen übrig, Jetzt, wo dieses gefräßige Huhn weg ist«, grinste der Neue, der unsere Abschiedsszene beobachtet hatte.
»Halt dein blödes Maul«, erwiderte ich.
Trauriges Finale
Geschlossene Abteilung; zwei Monate später
»Hast du was von Miriam gehört, Rolf? Habe sie seit Juni nicht mehr gesehen.«
»Du weiß das gar nicht?«
»Nein, habe mich ausnahmsweise mal acht Wochen draußen gehalten. Ist ein langer Zeitraum, in dem viel passieren kann.«
»Da sag‘ ste was, Henning. Miriam ist tot.«
»WAS?«Ich blickte Rolf mit aufgerissenen Augen an.
»Die konnten ihr in der anderen Klinik anscheinend auch nicht richtig helfen. Das Essen blieb nicht drin. Künstliche Ernährung funktioniert wohl auch nicht unbegrenzt. Sie magerte immer mehr ab und fiel irgendwann ins Koma. Bis dann die lebenswichtigen Organe versagten.«
»Woher weißt du das?«
»Hat mir Pfleger Martin erzählt. Und der hatte es wiederum vom Stationsarzt. Wird schon stimmen. Die Quelle ist zuverlässig.«
»Tut mir leid um die Kleine. Ich konnte sie gut leiden«, sagte ich nachdenklich.
»Mal schau’n, wen es als nächstes erwischt. Vielleicht einen von uns beiden, Henning.«
»Tja, weiß man nicht. Ist halt ein riskantes Spiel, das wir hier alle betreiben.«
An diesem Abend verspürte ich keinen Appetit und ließ mein Essen unangerührt in die Küche zurückgehen.
Bild von: Gerd Altmann auf pixabay