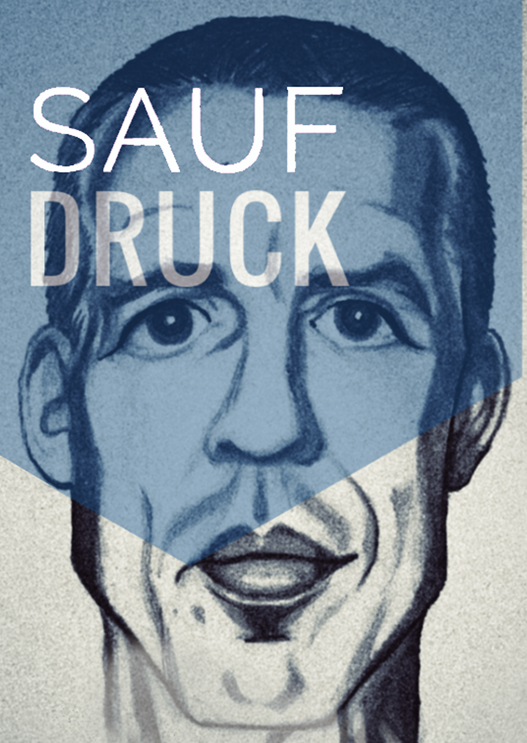Als meine Mutter vor fünf Jahren starb, hinterließ sie mir ein zwölfteiliges Service Maria Weiß. Warum ausgerechnet ich als Sohn das Maria Weiß erhielt, weiß ich nicht, weil ich mir ehrlich gesagt nie viel aus Porzellan oder gar Maria Weiß gemacht hatte.
Tagebuch 11. Dezember
Als meine Mutter vor fünf Jahren starb, hinterließ sie mir ein zwölfteiliges Service Maria Weiß. Sie hatte ihr Leben lang Porzellan geliebt und gesammelt, und es mussten am Ende immer zwölf Teile sein. Warum ausgerechnet ich als Sohn das Maria Weiß erhielt, weiß ich nicht, weil ich mir ehrlich gesagt nie viel aus Porzellan oder gar Maria Weiß gemacht hatte. Und was ich mit einem 12-teiligen Service anfangen sollte, wusste ich schon gar nicht und bat deshalb meine Exfrau darum, die Teller, Tassen, Saucieren und was alles sonst noch dazu gehörte für mich aufzubewahren. Denn auch meine Exfrau mag Porzellan sehr gerne, wenngleich sie anderen Manufakturen als den von meiner Mutter bevorzugten den Vorrang gibt. Ich selber gewöhnte es mir in meinen Studententagen an, nicht mehr als drei Teller, Tassen und Gläser im Küchenregal stehen zu haben. Und die hatte ich schon, als meine Mutter starb, weshalb das 12-teilige Maria Weiß schlichtweg zu viel für meine spartanische Küche gewesen wäre.
Immer, wenn ich meine Exfrau besuche, stellt sie einen Espresso in einer der 12-Maria-Weiß-Mokkatassen vor mich hin. Hin und wieder diskutieren wir darüber, ob man Espresso überhaupt in einer Mokkatasse reichen darf; aber zur Zeit, als meine Mutter dieses Geschirr sammelte, war Espresso noch was sehr Exotisches, was man nur aus dem Italienurlaub kannte, und mir ist es eigentlich egal, ob ich meinen Espresso aus einer Mokka- oder einer Espressotasse trinke. Letztlich schmeckt Espresso eh nur, wenn er in einer Original-Cimbali zubereitet wird, und deshalb ist es doppelt egal, ob meine Exfrau ihn in einer ursprünglich für Mokka gedachten Tasse serviert. Nicht, dass sie nicht ebenfalls moderne Espressotassen im Schrank stehen hätte. Ich bin es, der jedes Mal auf der altertümlichen Maria-Weiß-Mokkatasse beharrt. So oft habe ich das in den vergangenen fünf Jahren getan, dass ich sie mittlerweile automatisch vorgesetzt bekomme. Auch von meinen Kindern, die Maria Weiß vorher nur aus der Vitrine ihrer Großmutter kannten.
Sobald ich den Espresso aus der Mokkatasse meiner Mutter trinke, schweifen meine Gedanken in diesen zwei Minuten – länger dauert es im Durchschnitt nicht, einen Espresso zu trinken – zurück in die Zeit meiner Kindheit, als Maria Weiß jeden Morgen als Frühstücksgeschirr bei uns auf dem Tisch stand. Ohne Mokkatasse, denn niemand von uns trank Mokka zum Frühstück. Meine Eltern waren notorische Schwarzteetrinker und ich und meine Schwester bekamen abwechselnd Hagebuttentee und Kakao hingestellt, bevor wir uns auf den Weg in die Schule machten. Es war eine weitgehend unspektakuläre Kindheit, eine Kindheit, die bei vielen Kindern in unseren Nachbarsfamilien exakt so ablief wie in unserer Familie, ebenfalls mit Hagebuttentee und Kakao zum Frühstück, jedoch nicht auf Maria-Weiß-Geschirr. Dieses Geschirr war damals eine Spezialität meiner Mutter gewesen.
Die Ehe meiner Eltern, die ziemlich genau 51 Jahre andauerte, bis als erster von beiden mein Vater starb, war nicht durchgängig glücklich, erlebte periodische Aufs und Abs; und trotzdem wären weder mein Vater noch meine Mutter jemals auf die Idee gekommen, sich auch nur probeweise zu trennen. Scheidung kam nicht in Frage, denn die war was für triebhafte Menschen und Hollywood-Schauspieler, nicht jedoch für meine Eltern, die zeitlebens in den strengen Regeln ihrer bürgerlichen Erziehung gefangen waren. Ob ihr Weg des 51-jährigen Auf und Ab oder meiner der Scheidung und des nunmehr zehnjährigen Singledaseins der bessere ist, weiß ich nicht. Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile. Fest steht nur, dass meine Mutter den Tod ihres Mannes nie richtig verkraftet hat, danach immer sonderbarer und vergesslicher wurde, bis sie sich schließlich nur noch an seinen Namen und den ihres Vaters, nicht aber an den ihrer Kinder und Enkel erinnern konnte.
All das geht mir in den zwei Minuten durch den Kopf, wenn ich den Espresso aus der Maria-Weiß-Mokkatasse meiner Mutter trinke und dabei vor mich hin träume, den blassen Hauch meiner lang versunkenen Kindheit wie eine Idee von Glück über diese Tasse hinwegziehen zu sehen.