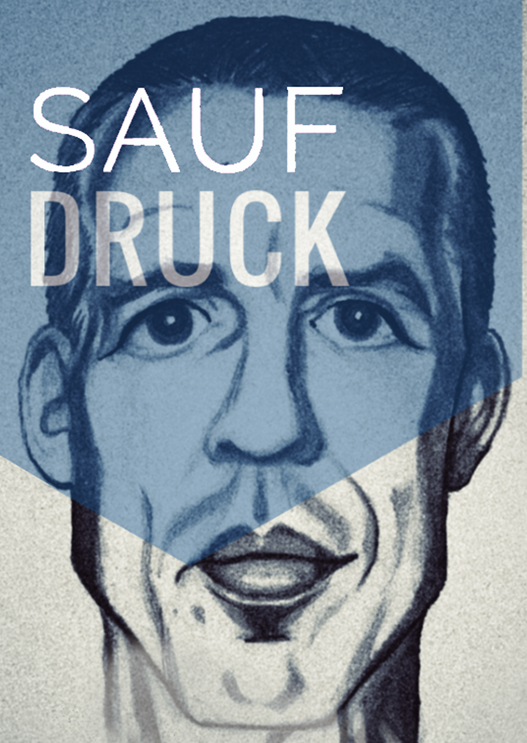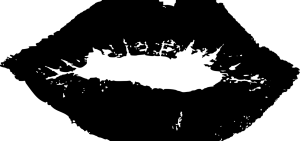In Teil 2 hasse ich mich für Anflüge von Eifersucht, suche schnelles Vergessen im Alkohol und habe einen mehrtägigen Filmriss.
Mein Verstand hatte sich mit dem Abschied schon längst abgefunden. Einzig meine Emotionen hinkten hinterher. Ich hasste es, wenn meine Gefühlswelt aus den Fugen geriet.
Nutzloses Spiel mit dem Tod
Der Mahner in mir meldete sich: »Sei froh, dass es so gekommen ist. Es hätte noch schlimmer ausgehen können. Akzeptiere ihre Entscheidung und sortiere dein Leben von Grund auf neu«.
Ich schrie ihn an: »Was weißt du schon von Liebe und Glück? Du bist nur mein langweiliges Gewissen. Lass mich in Ruhe«. Er erwiderte: »Du verwechselst Liebe mit Sex. Alle deine Frauen sagen es dir. Höre auf sie. Besinne dich auf dich selbst und geh endlich in eine Therapie«.
Mich packte Zorn, Tränen stiegen mir in die Augen. Ich riss Grasbüschel aus der Wiese und trocknete mein Gesicht. Vom Fluss herstammend ließ sich eine Stimme vernehmen: »Was grämst du dich, Fisch? Steige hinab in meine dunklen Tiefen und finde dort dein Vergessen«. Ich ging ans Ufer und starrte auf die schwarzen Wellen des Stroms. Nach einem kurzen Moment drehte ich mich abrupt um. Ich war noch nicht so weit. Bis jetzt spielte ich mit dem Tod oder er mit mir. Mein Vater hatte vor einiger Zeit zu mir gesagt: »Früher haben sich Männer in deiner Situation erschossen«. Mir war bis heute nicht klar, ob er diese Worte bloß zum Spaß oder doch ernst an mich gerichtet hatte. Ich wollte aber in diesem Moment nicht sterben. Wozu auch?
Wer garantierte mir, dass es mir im Jenseits besser gehen würde als auf dieser elenden Erde? Vielleicht würde mich Gott bis in alle Ewigkeit mit meinen Sünden konfrontieren. Ob er vorhatte, mir zu vergeben? Wahrscheinlich war ich so unwichtig, dass er sich überhaupt nicht mit mir beschäftigen wird. Dann lieber noch ein paar Jahre weiter leben. In welcher Form auch immer. Ich öffnete den zweiten Wodka und trank ihn in einem Zug aus.
Eifersucht ist ein furchtbares Gefühl
4.42
Mein Telefon klingelte. Wer rief mich um diese nachtschlafende Uhrzeit an? Mit trüben Augen starrte ich auf’s Display. Es war sie. Was wollte sie von mir? Reden. Wozu? Es war alles gesagt worden. Zudem würde sie mir vorhalten, dass ich lallte. Das würde mich noch mehr abfucken, als ich es ohnehin schon war. Sie war hartnäckig. Das Dreckshandy läutete sage und schreibe ein Dutzend Mal, bis es endlich verstummte. Ein weiterer Ton erklang. Nun war eine SMS eingegangen. Mühsam entzifferte ich: »Wo bist du? Lass uns gemeinsam frühstücken. Ich mache mir Sorgen um dich«. Ich schmiss das Teil in hohem Bogen in die Fluten. Danach fühlte ich mich wohler.
Wie würde es nun weitergehen? Ich beschloss, das zu tun, was ich im Falle solcher Trennungen immer gemacht hatte: mich zu betrinken. Den Schmerz solange zu betäuben, bis mir alles egal geworden war. Die Vorhänge meines Appartements zuzuziehen, mich aufs Sofa zu legen und tagelang volllaufen zu lassen. Bis irgendwann die körperlichen Qualen die seelischen überlagerten. Es war ein ruppiger – aber durchaus bewährter – Weg der Reinigung. Ähnlich wie ein Fasten, das man durch Abführmittel beschleunigt.
Wie lange würde es dauern, bis ein Neuer meinen Platz eingenommen hatte? Sie war niemand, der gerne alleine blieb. Wahrscheinlich war bereits heute Abend mein Platz in ihrem Bett an meinen Nachfolger vergeben. Irgendeinen gutbetuchten Steuerberater aus einer dieser Akademikerbörsen im Internet. Bei diesem Gedanken schüttelte es mich. Mein Herz klopfte bis in meine Schläfen hinein. Brechreiz überkam mich. Ich war kurz davor, mich zu übergeben. Und erneut haderte ich mit mir selbst. Eifersucht war eines der Gefühle, das ich am meisten verabscheute. Invidia: eine der sieben Todsünden. Sie strangulierte einen wie ein tollwütiger Krake. Nahm mir die Luft zum Atmen. Und ließ einen dann für Wochen nicht mehr los. Ich sprang von der Bank auf und schüttelte mich. Ich wollte diesen niederen Instinkt auf keinen Fall an mich heranlassen.
5.17
Der Morgen dämmerte herauf. Die ersten Sonnenstrahlen ließen vermuten, dass es auch heute wieder ein heißer Tag werden würde. Ich marschierte zur nächsten Tankstelle und deckte mich dort mit Vorräten ein.
Der Exorzismus hat mal wieder funktioniert
Zehn Tage später. Nachmittags
»Hallo, Herr Hirsch. Schön, dass Sie endlich wieder zu sich kommen.«
Über mir stand Schwester Veronika. Von uns liebevoll Black Mamba genannt. Wegen ihrer Vorliebe für hautenge schwarze Bodies. Sie passte eher als Ninjakämpferin in einen japanischen Schwertfilm als in dieses Krankenhaus. Ich freute mich, sie zu sehen. Sehr viel besser als beim Aufwachen in die bösen Augen von Pfleger Jürgen schauen zu müssen.
»Wissen Sie überhaupt, wie Sie hierhergekommen sind?«
»Keinen blassen Dunst.«
»Wir haben sie mehr tot als lebendig vorgestern aus Ihrer Wohnung rausgeholt. Das war allerletzte Eisenbahn. Sie wären beinahe abgekratzt.«
»Klingt übel.«
»Da sagen Sie was. Ruhen Sie sich aus, und kommen Sie langsam wieder auf die Beine. Medikamente bringe ich Ihnen gleich vorbei.«
Der Tod hatte mich also auch dieses Mal verschont. Er wollte mich einfach nicht mitnehmen. Weshalb? Weil ihm Komasaufen zu simpel war? Nicht dramatisch genug? Warum konnte ich nicht für immer einschlafen? Musste ich erst an meinem Erbrochenen ersticken? Oder betrunken vom Balkon in einen Müllcontainer fallen? Standen mir als Fisch – ähnlich wie der Katze – vielleicht neun Leben zur Verfügung? Wie viele davon hatte ich mittlerweile aufgebraucht?
Der Entzug setzte nun mit aller Gewalt ein. Nahezu alle Körperfunktionen spielten verrückt. Ich drückte auf den Alarmknopf. Hoffentlich beeilte sich Veronika mit den Pillen. Andernfalls würde ich den heutigen Abend sicherlich nicht mehr erleben.
Was war mit ihr? Spürte ich noch Liebeskummer oder gar Eifersucht? Nein, ich war emotional vollkommen kalt. Ich konnte mich nur schemenhaft an die vergangenen Monate mit ihr erinnern. Das Höllenexperiment mit dem Alkohol hatte wie ein Exorzismus auf mich gewirkt. Der Dämon war aus meinem Gedächtnis getilgt. Hoffentlich für immer. In meiner Hosentasche entdeckte ich den Kiesel. Ein Abschnitt meines Lebens war unwiderruflich vorbei.
—–
Hier geht’s zurück zu Teil 1.
Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay